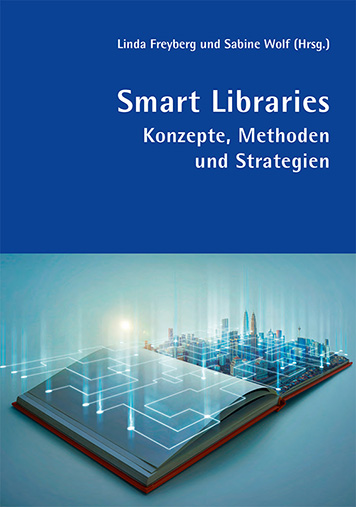Mit dem Start von Google Scholar am 18. November 2004 wurde die Art und Weise der Suche nach wissenschaftlichen Informationen tiefgreifend verändert. Vor Google Scholar mussten sich Forschende für eine Literaturrecherche zuerst persönlich in eine wissenschaftliche Bibliothek begeben und dort spezialisierte Datenbanken nach passender Fachliteratur durchsuchen. Auch nach Google Scholar bleiben solche fachspezifischen Datenbanken in wissenschaftlichen Bibliotheken unverzichtbar, vor allem wenn...
Kategorie
Zurückgezogene wissenschaftliche Arbeiten leben häufig weiter
Das Peer-Review-Verfahren gilt als der Goldstandard bei der wissenschaftlichen Qualitätssicherung. Trotz dieser Kontrollen kommt es immer wieder vor, dass Arbeiten wegen Betrugs, Fälschungen, Plagiaten, Verwendung falscher Daten etc. zurückgezogen werden müssen. Diese Arbeiten können jedoch von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in ihren Forschungsarbeiten zitiert werden. Dadurch besteht die mehr als theoretische Gefahr, dass die in den zurückgezogenen Fachbeiträgen enthaltenen...
Vergleichsstudie zu Abstract-Datenbanken
Generell sind Fachzeitschriften noch immer die wichtigste Quelle für Forschende, wenn sie sich über neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf ihrem Fachgebiet informieren wollen. Um solche Inhalte zu finden, stehen heute zahlreiche den Volltext indexierende und durchsuchende Suchmaschinen zur Verfügung. Für Informationsspezialisten jedoch sind bibliografische Abstracting-und-Indexing-Datenbanken nach wie vor das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, relevante Forschungsliteratur zielgenau zu...
Wer, wie, was: Literaturdatenbanken im Vergleich
Wenn Wissenschaftler an einem Forschungsprojekt arbeiten, ist es für sie essenziell, die zu diesem Thema bereits veröffentlichten Publikationen zu finden. Außerdem müssen sie sich fortlaufend in ihrem Fachgebiet auf dem Laufenden halten, um allgemein über neue Entwicklungen informiert zu sein. Die Forscher greifen bei der dafür notwendigen Informationssuche zunehmend auf die akademische Suchmaschine Google Scholar zurück. Aber auch klassische wissenschaftliche Datenbanken, wie Scopus oder Web...